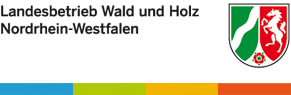Waldentwicklungsberatung:
Erfahrungsaustausch zum Einsatz von Wuchshüllen
Anfang Februar trafen sich, im Rahmen der regionalen Waldentwicklungsberatung, Forstleute des Regionalforstamtes Ostwestfalen-Lippe (RFA OWL) im Forstbetriebsbezirk (FBB) Petershagen zu einem Austausch zum Thema Wiederbewaldung von Kalamitätsflächen.
Neben allgemeinen Themen der Wiederbewaldung und anschaulichen Beispielen zu extrem wüchsiger Konkurrenzvegetation ging es um den Austausch von Erfahrungen mit verschiedenen Wuchshüllen und anderen Einzelschutzprodukten.
Das wachsende Bewusstsein für die Mikroplastik-Problematik und die riesigen Kalamitätsflächen im Land, bringen in Sachen Wuchshüllen seit wenigen Jahren einen erheblichen Innovationsschub mit sich. Neben den Wuchshüllen aus erdölbasiertem Kunststoff kommen inzwischen zahlreiche neue Produkte aus anderen Materialien zum Einsatz. Dabei ist nicht jedes neue Produkt in der Praxis ein Erfolg. Vor- und Nachteile der neuen und altbewährten Produkte auf dem beinahe unübersichtlichen Markt zu identifizieren, liegt naturgemäß im Interesse der Dienstleistungsförsterinnen und -förster.
Zu den klassischen Wuchshüllen war die überwiegende Meinung, dass die ursprünglich damit verbundene Funktion, als eine Art Minigewächshaus wachstumsfördernd zu wirken, in der Herausforderung der Wiederbewaldung von Kalamitätsflächen eher nebensächlich ist.
Die Möglichkeit, Verbiss- und Fegeschutz ohne Zaun, bzw. mit weniger wiederkehrenden Aufwand als bei Verbisschutzmitteln, zu gewährleisten, steht im Vordergrund. Dabei können auch kleine Pflanzensortimente Verwendung finden, die bei geringeren Kosten deutliche Vorteile für den Anwuchs und die ungestörtere Wurzelentwicklung versprechen.
Zunehmend gewinnt aber auch der Aspekt der erheblichen Vereinfachung der Kulturpflege an Bedeutung. Durch die Wuchshüllen können zu pflegenden Bäumchen auf Flächen mit starker und sehr problematischer Konkurrenzvegetation wie Adlerfarn und Brombeere leichter gefunden werden.
Um Misserfolge zu vermeiden, ist zu bedenken, dass Wuchshüllen einen Teil des Lichtes abhalten, was beim Einsatz in noch überschirmten Flächen berücksichtigt werden sollte. Auf stark besonnten Flächen drohen bei geschlossenen Wuchshüllen hingegen Schäden durch Überhitzung. Bei stauender Feuchtigkeit wurden auch Schäden durch Verpilzung beobachtet. Der Einsatz von geschlossenen Wuchshüllen bei immergrünen Nadelhölzern, wie zum Beispiel Douglasie, ist aus wachstumskundlichen Gründen, umstritten.
Auch beim Einsatz von Wuchshüllen muss eine regelmäßige Kontrolle eingeplant werden. Probleme durch Schiefstand sowie Triebverkrümmung (besonders bei Buche) oder das Auswachsen durch Belüftungslöcher können, sofern rechtzeitig bemerkt, dabei leicht behoben werden.
Bei Wuchshüllen aus biologisch abbaubaren Materialien steht unter anderem der Vorteil im Raum, dass diese nach dem Ende des Schutzzwecks in der Fläche verrotten können. Damit entfällt im Gegensatz zu Hüllen aus waldfremden Materialien der Aufwand für den Abbau und die Entsorgung, was in der Kalkulation zu berücksichtigen ist. Immerhin sind die biologisch abbaubaren Wuchshüllen zumeist teurer in der Anschaffung.
Leider scheint die Frage, ob nicht auch Wuchshüllen aus biologisch abbaubaren Materialien nach Beendigung des Schutzzwecks als Abfall zu bewerten und folglich zu entsorgen sind, zur Zeit rechtlich nicht abschließend geklärt zu sein. Auch die Frage, welche Wuchshüllen tatsächlich als biologisch abbaubar bezeichnet werden dürfen, ist bisher nicht verbindlich geregelt. Eine Din Norm für biologisch abbaubare Wuchshüllen wird derzeit entwickelt. Daran soll nachvollziehbar erkennbar sein, für welche Produkte aus umweltökologischen Gründen keine Notwendigkeit des Rückbaus besteht.
Das Landesforstgesetz NRW verbietet in §3 Abs. 3 Nr. 1 LFoG NW mit Bezug zu Hordengattern, waldfremde Materialien im Wald zu belassen. Übertragen auf den Einsatz von Wuchshüllen könnten solche aus unbehandeltem Holz ohne Fremdstoffe (zum Beispiel Kabelbinder) im Wald verbleiben.
PEFC verpflichtet zertifizierte Waldbesitzer dazu, den Einsatz von Produkten aus erdölbasierten Materialien, wie Wuchshüllen, Fege-/Verbiss-/Schälschutz und Markierungsbänder, möglichst zu vermeiden. Soweit am Markt verfügbar und wirtschaftlich zumutbar, sollten Produkte verwendet werden, deren Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen stammen. Nicht mehr funktionsfähige Wuchshüllen und solche, die ihren Verwendungszweck erfüllt haben, müssen aus dem Wald entnommen und fachgerecht entsorgt werden.
Der Waldtermin zum Austausch der Forstleute des Regionalforstamtes OWL wurde allgemein als gelungen und dringend notwendig empfunden. Es wurde angeregt, neben den bewährten Wuchshüllen weitere neue Produkte zu testen und die Erfahrungen damit den Kollegen zugänglich zu machen. Versuchsflächen mit verschiedenen Wuchshüllen im direkten Vergleich wären wünschenswert.
Ähnliche Termine an Beispielsflächen zum Erfahrungsaustausch in waldbaulichen Fragen (und auch zum Thema Wuchshüllen) im Kollegenkreis sollen von Zeit zu Zeit folgen. Für besondere Beratungen zu waldbaulichen Herausforderungen steht der Waldentwicklungsberater den Kolleginnen und Kollegen auf Anfrage gerne zur Verfügung.
Autor: Markus Uhr, Wald und Holz NRW
Kontakt
Waldblatt Herbstausgabe 2024
Überregional
Umfrageergebnisse: Volles Vertrauen in die Försterinnen und Förster
Thomas Wälter: Wir müssen vielfältig in unseren Wald investieren
Einheitsforstverwaltung in NRW bleibt bestehen
Praxishinweise zur Werbung von Wildlingen
Synchronisation der Wertschöpfungskette Forst-Holz
Ihr Regionalforstamt
Mit Paintballs im Einsatz für die Wissenschaft
Waldblatt Herbstausgabe 2024
Überregional
Umfrageergebnisse: Volles Vertrauen in die Försterinnen und Förster
Thomas Wälter: Wir müssen vielfältig in unseren Wald investieren
Einheitsforstverwaltung in NRW bleibt bestehen
Praxishinweise zur Werbung von Wildlingen
Synchronisation der Wertschöpfungskette Forst-Holz
Ihr Regionalforstamt
Mit Paintballs im Einsatz für die Wissenschaft