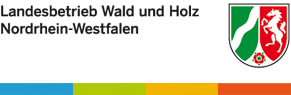Zweifleckiger Eichenprachtkäfer
Eine Gefahr im Wirtschaftswald
Beim Eichenprachtkäfer handelt es sich um eine wärmebedürftige Art. Der Befall tritt normalerweise in Folge von vorausgegangen Schädigungen des Baumes auf, zum Beispiel durch Witterungs- oder Klimaeinflüsse, Pilzbefall oder Fraßeinwirkungen anderer Schädlinge. Der zweifleckige Eichenprachtkäfer erreicht eine Länge von ca. 10-12mm, im letzten Drittel hat der Käfer zwei weiße Punkte. Die weiblichen Prachtkäfer legen ihre Eier in Rindenritzen der Eichen ab. Häufig sind die „Wirtsbäume“ geschwächt, z.B. durch Eichenfraßgesellschaften oder durch Trockenstress.
Die Larven fressen treppen- oder zick-zack förmige Gänge im Bast, dabei legen sie zur Überwinterung und zur Verpuppung eine Kammer an. Der Entwicklungszyklus dauert je nach Witterungsverhältnissen 1-2 Jahre. Die fertig entwickelten Käfer schlüpfen im Mai. Die typischen Ausbohrlöcher der adulten Käfer sind halbmond- bzw. D-förmig.
Der Eichenprachtkäfer legt seine Eier bevorzugt im Kronenansatz ab, daher sind die Ausbohrlöcher der Käfer schwer oder nicht zu sehen. Ein Indiz für den Befall sind trockene Kronen, Spechtabschläge und Bohrmehl des Eichenkernkäfers, dessen Befall häufig mit dem des Eichenprachtkäfers einhergeht. Tendenziell ist der Eichenprachtkäfer ein sekundärer Schädling (Befall vorgeschädigter Bäume), durch seine hohe Vermehrungsrate und cluster-artigen Befall ist der Käfer innerhalb der letzten Jahre zu einem primären Schädling (Befall gesunder Bäume) geworden, der großen Schäden in alten Eichenbeständen anrichten kann.
Ursachen des Befalls
Milde Winter und trockene Sommer erhöhen das Risiko für Trockenstress in den Beständen. Daraus resultierender Wassermangel, insbesondere während der Vegetationszeit, schwächt den Abwehrmechanismus der Eichen. Die Lebensbedingungen der Eichenprachtkäfer verbessern sich. Aus diesem Grund ist die Eichenprachtkäferpopulation in den letzten Jahren angestiegen.
Sanitärhiebe sind die einzige Möglichkeit „clusterartigen“ Befall des Prachtkäfers zu unterbinden und den Druck auf Nachbarbäume und -bestände zu minimieren.
Die Minderung bzw. die Unterbindung des Befallsdrucks ist das oberste Ziel der Maßnahme, denn so können wertvolle Eichenbestände mit ihren vielseitigen Funktionen erhalten werden:
- Erhalt der Eiche als wichtigste Habitatbaumart (Naturschutzfunktion)
- Erhalt von Beständen mit kulturhistorischer Bedeutung
- Erhalt von wertholzhaltigen Eichenbeständen
Behandlungsempfehlung
Gefährdete Eichenbestände sollten mindestens zweimal jährlich einzelbaumweisebegutachtet werden. Die Flugzeit der Käfer beginnt im Mai, aufgrund der ausbleibenden Photosynthese-Leistung kann der Befall anhand des Belaubungszustandes im Herbstnachgewiesen werden. Das Bohrmehl des Kernkäfers und Spechtabschläge können ganzjährig begutachtet werden, ausbleibendes Feinreisig in der Krone kann im unbelaubten Zustand ein wichtiges Befalls-Indiz sein. Ein hoher Totholzanteil im Kronenbereich, deutet ebenfalls auf Befall hin. Eichen mit Schleimflussflecken sollten bei vitaler Krone nicht entnommen werden, da die Schleimflussflecken auf ein intaktes Abwehrsystem der Eichen hindeuten.
Alte Eichenwälder sind häufig reich an Totholz und an Habitatbäumen, im Zweifelsfall sollten nach Rücksprache mit den Beauftragten der Unteren Naturschutzbehörde und der Revierleitung auch befallene Habitatbäume entnommen werden, um so den Erhalt des Bestandes gewährleisten zu können und „clusterartigen“ Prachtkäferbefall zu vermeiden. Gegebenenfalls ist es sinnvoll die Maßnahme zur Sicherung des Eichenhabitats medienwirksam zu kommunizieren, um Missverständnissen mit erholungssuchender Bevölkerung und Naturschutzverbänden entgegenzuwirken.
Die Eingriffe sind sorgsam zu planen da ein die Entnahme befallener Eichen das Bestandesinnenklima negativ beeinflussen und so die die Populationsdynamik des Prachtkäfers beschleunigen kann. In den letzten niederschlagsarmen Jahren wurde allerdings auch Befall in geschlossenen Eichenbeständen nachgewiesen. Tendenziell könnte es sich bei „clusterartigen“ Befall anbieten, die Eiche in Form von Kunstverjüngung femel- oder lochartig nachfolgend in Kultur zubringen.
Von trockenen bzw. „toten“ Eichen geht keine Gefahr mehr aus, da der Bast des Wirtsbaumes vollständig ausgetrocknet ist und dem Käfer somit kein Brutraum mehr zur Verfügung steht. Inwieweit eine Eiche vollständig abgestorben ist, sollte dennoch einzelbaumweise geprüft werden, da auch aus absterbenden Eichen noch Käfer ausfliegen können.
Da Eichenbestände mit Prachtkäferbefall häufig totholzreich sind, gilt es bei der Einschlagsplanung auf die entsprechenden Gefahren beim motormanuellen Holzeinschlag im Arbeitsauftrag hinzuweisen.
Das befallene Holz lässt sich bei frühzeitiger Erkennung noch angemessen vermarkten, wenn der holzentwerdende Befall des Eichenkernkäfers nicht zu groß ist.
Weiter gilt es das Holz möglichst weit entfernt vom Bestand zu poltern, da der Prachtkäfer mehrere Kilometer schwärmen kann. Das Kronenholz ist bis zu einer Stärke von >12cm aufzuarbeiten und lässt sich ggf. als Energieholz nutzen. Diese Vorkehrungen dienen dem Brutraumentzug des Eichenprachtkäfers.
Das Holz sollte frühzeitig abgefahren werden.
Autor: Felix Losemann, Wald und Holz NRW
Kontakt
Weiterführende Informationen
Waldblatt Herbstausgabe 2024
Überregional
Umfrageergebnisse: Volles Vertrauen in die Försterinnen und Förster
Thomas Wälter: Wir müssen vielfältig in unseren Wald investieren
Einheitsforstverwaltung in NRW bleibt bestehen
Praxishinweise zur Werbung von Wildlingen
Synchronisation der Wertschöpfungskette Forst-Holz
Ihr Regionalforstamt