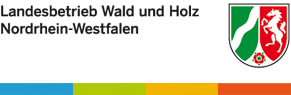Erfahrungen PEFC-Audits in Forstbetriebsgemeinschaften
Die Zertifizierung von Forstbetrieben ist seit vielen Jahren Praxis. In Nordrhein-Westfalen und auch im Forstamt hat die PEFC-Zertifizierung flächenmäßig den größten Anteil. Mit einer Selbstverpflichtungserklärung wird bestätigt, dass der PEFC-Waldstandard eingehalten wird. Dies wird stichprobenmäßig mit PEFC-Audits kontrolliert: Unabhängige, qualifizierte und akkreditierte Fachleute überprüfen vor Ort, ob die forstliche Praxis die Standards nachhaltiger Waldwirtschaft erfüllt.
Neben den fachlichen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Waldwirtschaft hat eine Zertifizierung auch finanzielle Auswirkungen. So richtet sich die Höhe der Förderung forstlicher Dienstleistungen nach dem Anteil der zertifizierten Mitgliedsfläche einer FBG. Sie ist außerdem Voraussetzung für das Bundesförderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ sowie für die Ausstellung von CO2-Zertifikaten beispielsweise nach dem Wald-Klimastandard der Ecosystem Value Association. Unternehmen mit einer Chain-of-Custody-Zertifizierung sind auf zertifizierte Forstbetriebe angewiesen, um ihren steigenden Bedarf an PEFC-Holz zu decken. Darüber hinaus setzen private und öffentliche Auftraggeber auf PEFC im Rahmen von Ausschreibungen. Die Einhaltung des Standards und der Erhalt des Zertifikats sind somit wichtig.
Die Vor-Ort-Audits umfassen einen repräsentativen Anteil der Betriebe in einer Region. Die forstlichen Gutachter der Zertifizierungsstellen entscheiden bei Verstößen über die Sanktionen (Korrekturen, Re-Audit, Entzug der Urkunde). Um einem Zertifikatsverlust vorzubeugen, stellt das Forstamt nachfolgend wichtige Erfahrungen aus aktuellen Audits vor:
- Mitgliedsbetriebe müssen in der Kommunikation die PEFC-Deklaration inklusive der Zertifikatsnummern beachten.
- Die PEFC-Standards müssen bekannt sein und über Änderungen muss regelmäßig informiert werden (z.B. PEFC-Newsletter).
- Bodenschutz: Auf eine pflegliche Holzernte ist zu achten, Gleisbildung soll möglichst vermieden werden. Flächiges Befahren ist grundsätzlich zu unterlassen.
- Zum Schutz vor Kunststoffrückständen wird der Einsatz von erdölbasierten Materialien wie Wuchshüllen, Fege-/Verbiss-/Schälschutz möglichst vermieden.
- Mit Ausnahme natürlicher Reinbestände werden Mischbestände mit standortgerechten Baumarten erhalten/aufgebaut (2. Baumart mind. 10%).
- Soweit verfügbar wird geprüftes Saat- und Pflanzgut verwendet. Die Identität wird durch ein anerkanntes Verfahren bzw. kontrollierte Lohnanzucht sichergestellt.
- Waldbesitzer wirken auf angepasste Wildbestände hin. Sie gelten als angepasst, wenn die Verjüngung der Hauptbaumarten ohne Schutzmaßnahmen möglich ist […] und frische Schälschäden an den Hauptbaumarten nicht großflächig auftreten.
- Bei eigenem Personal, beauftragten Unternehmen und Selbstwerbern ist auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften zu achten (Fälltechnik, Rettungskette u.a.).
Die hier aufgeführten Erkenntnisse aus aktuellen Audits zeigen nur einen Ausschnitt des Standards, der einzuhalten ist. Daher empfiehlt das Forstamt, sich regelmäßig mit den Vorgaben zu befassen und einzelne Punkte in FBG-Versammlungen oder Waldbegängen zu thematisieren.
Autor: Frank Rosenkranz, Forstamtsleiter
Ansprechperson
Martin Kempkes
REGIONALMANAGER NORDRHEIN-WESTFALEN
E-Mail: senden
Mobil: +49 160 977 285 22
Waldblatt Sommerausgabe 2024
Überregional
Digitale Angebote zur Förderung
Bauen mit Birke – der Weg in die Norm
Nasses Frühjahr – vitale Waldbäume?
Die neue Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten „EUDR“ (Stand: 06.06.2024)
Ihr Regionalforstamt
Kyrillbestände pflegen - ist der Zeitpunkt verpasst?