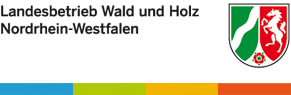Land untersucht Perspektiven des Privatwaldes
Im Rahmen des Forschungsprojektes „Zukunftsperspektiven für den Privatwald in NRW“ wurden die ökonomischen Auswirkungen der Sturm-, Dürre- und Borkenkäferkalamitätsjahre seit 2018 auf den Privatwald in Nordrhein-Westfalen untersucht.
Ziel des Projektes war es, die ökonomische Betroffenheit des Privatwaldes abzuschätzen und die mit verschiedenen Bewirtschaftungs- und Wiederbewaldungsstrategien verbundenen betriebswirtschaftlichen Folgen für Forstbetriebe aufzuzeigen. Das Projekt wurde vom Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit der Abteilung Forstökonomie und nachhaltige Landnutzungsplanung der Universität Göttingen im Auftrag des Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz durchgeführt.
Die Ergebnisse belegen mit Hochrechnungen, dass der Privatwald in NRW nicht nur durch Verlust der Bäume, sondern auch betriebswirtschaftlich ganz erheblich betroffen ist. Bei einer Kalamitätsfläche von 79.000 ha im Nadelholz wird der Gesamtschaden bis Ende 2021 auf 1,63 Mrd. Euro geschätzt. Beispielhafte Untersuchungen in einzelnen Forstbetrieben des Klein- und Mittelprivatwaldes zeigen, dass die Baumarten- und Altersklassenverteilung der Bestände sowie der Zeitpunkt des Schadholzverkaufs die entscheidenden Faktoren für die ökonomische Situation sind. Der Grund dafür liegt insbesondere in dem erheblichen Preisverfall beim Schadholzverkauf in NRW im Verlauf der Kalamität bis Ende 2020. Erst später erholten sich die Preise wieder.
Die zukünftigen Herausforderungen für die privaten Forstbetriebe werden darin bestehen, dass der substanzielle Verlust in der Fichte vielfach zu Liquiditätsengpässen führen wird. Die Modellierungsergebnisse zu verschiedenen Handlungsoptionen hinsichtlich der Wiederbewaldung zeigen, dass davon insbesondere Betriebe mit größeren Kalamitätsflächenanteilen betroffen sein werden. Unter Berücksichtigung des in den Beständen gebundenen Kapitals zeigt sich aber auch, dass – bei einer aktiven Bewirtschaftung der Kalamitätsflächen und unter Inanspruchnahme von Fördermitteln für die Wiederbewaldung – die Bewirtschaftung in den ersten Jahrzehnten nach Kalamität rentabel sein kann. Szenarien mit besonders rentabler, nadelholzgeprägter Wiederbewaldung sind wegen mangelnder Naturnähe weniger resistent gegen Klimaschäden. Deshalb ist das weniger rentable Laubholz wichtig zur Erreichung von Stabilitäts- und Biodiversitätszielen in den Betrieben. Die Förderung von Laubholz ist daher ein wichtiges forstpolitisches Instrument, um im privatwaldreichsten Bundesland Biodiversitätsziele im Wald zu erreichen.
Den beschriebenen Liquiditätsengpässen können Fortbetriebe in unterschiedlichen zeitlichen Ebenen begegnen. Ein Abpuffern ist durch die Bewirtschaftung ihrer nach der Kalamität verbliebenen Bestände, durch die Berücksichtigung von Nadelbaumarten bei der Wiederbewaldung, durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln und ggf. durch Nutzung alternativer Einnahmemöglichkeiten denkbar. Unterstützung sollte der Privatwald insbesondere durch den langfristigen Erhalt von Förderung, die Berücksichtigung von ökonomischen Aspekten in der Privatwaldberatung und bei der Etablierung alternativer Geschäftsmodelle neben dem Verkauf von Rundholz erhalten.
Neben den Kalamitätsfolgen und Handlungsmöglichkeiten auf der Betriebsebene von Forstbetrieben sind auch überbetriebliche Aspekte untersucht worden. Vor- und Nachteile einer Professionalisierung von Zusammenschlüssen bei der Kalamitätsbewältigung wurden anhand eines Fallbeispiels beleuchtet. Die Vorteile für die FBG bestanden im Wesentlichen in der flexiblen und kundenorientierten Selbstvermarktung des Kalamitätsholzes und in der größeren Marktpräsenz bei Vertragsabschlüssen.
In einem weiteren Schritt wurden die Kalamitätsauswirkungen auf das Cluster Forst und Holz in NRW untersucht. Die Modellierung lässt nach Abklingen der Kalamität einen deutlich geringeren Nadelholzeinschlag im Vergleich zu den Vorkalamitätsjahren und gleichzeitig einen hohen Bedarf an Pflanzmaterial für die Wiederbewaldung erwarten. Die Auswirkungen der Kalamität auf verschiedene Branchen des Clusters fielen im Rahmen einer Expertenbefragungen sehr differenziert aus. Wesentliche Unterstützungsmöglichkeiten werden im Bereich der Grundlagenforschung für die technische Nutzung alternativer Baumarten, der Analyse des zukünftigen Rohholzpotenzials oder beim allgemeinen Bürokratieabbau gesehen.
Mit dem Projekt werden wesentliche Aspekte der betriebswirtschaftlichen Auswirkungen der Kalamität der Jahre nach 2018 auf den Privatwald und der nachgelagerten Branchen in NRW dargestellt. In betroffenen Forstbetrieben können nur in sehr langen Zeiträumen und unter verlässlichen Rahmenbedingungen nennenswerte Erträge erwirtschaftet werden. Die Kalamitätsauswirkungen haben das Geschäftsmodell des Nadelrundholzverkaufs grundlegend beeinflusst. Für private Forstbetriebe wird es wohl eine Generationenaufgabe sein, die kalamitätsbedingten Verwerfungen zu überwinden. Aufgrund der langen Produktionszeiträume ist die dabei bedeutendste Entscheidung, welche Strategie bei der Wiederbewaldung verfolgt wird. Sie ist damit maßgeblich für den zukünftigen Erfolg kalamitätsbetroffener Forstbetriebe verantwortlich.
Die Studie versteht sich auch als Ansporn für Waldbesitzerinnen und -besitzer, die Hände angesichts der Kalamität nicht in den Schoß zu legen, sondern entsprechend der eigenen Möglichkeiten und Vorstellungen für die kommenden Generationen einen zukunftsfähigen Wald zu schaffen.
Autor: Friedrich Reichert, Wald und Holz NRW