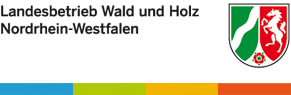Waldeigentum in der Krise
Ein Forschungsprojekt zeigt Herausforderungen und Perspektiven
Die Technische Universität München präsentierte im Oktober 2024 im Forstlichen Bildungszentrum von Wald und Holz NRW in Arnsberg die Ergebnisse ihres Forschungsprojekts „Waldeigentum in der Krise“. In Kooperation mit Wald und Holz NRW, der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und der Bayerischen Forstverwaltung analysierte das Projekt die Auswirkungen des Klimawandels und gesellschaftlicher Entwicklungen auf die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer und ihre Waldflächen. Für Waldbesitzende in Nordrhein-Westfalen bieten die Erkenntnisse interessante Einblicke und konkrete Ansätze für die Zukunft.
Ergebnisse zum urbanen Waldbesitz
Eine Erkenntnis des Projekts betrifft die Entwicklung des „urbanen Waldbesitzes“ aufgrund des allgemein vorangeschrittenen Agrarstrukturwandels der letzten Jahrzehnte, in dem Waldbesitz immer seltener an einen landwirtschaftlichen Betrieb gekoppelt ist. Der Anteil der Waldbesitzenden, die in Städten wohnen und daher oft eine räumliche Distanz zu ihrem Wald haben, hat zugenommen. Diese urbanen Waldbesitzenden sind durch andere Motivationen geprägt: Sie erkennen den aktuell hohen Bedarf der Waldpflege aufgrund der klimatischen Veränderungen, glauben aber auch an die Selbstregenation des Waldes. Sie sehen ihn weniger als wirtschaftliche Ressource, sondern vielmehr als Ort der Erholung. Der persönliche Bezug, oft durch Kindheitserlebnisse im Wald entstanden, verliert aufgrund räumlicher Distanz zum Wald an Bedeutung. Gleichzeitig äußern sie den Wunsch nach besserer Vernetzung und mehr Information, da der Zugang zu forstwirtschaftlichem Wissen und der Zugriff auf traditionelle forstwirtschaftliche Unterstützung vor Ort für sie schwieriger ist. Dies stellt neue Anforderungen an die forstliche Beratung und verdeutlicht den Bedarf an gezielten Angeboten für diese Waldbesitzergruppe.
Erkenntnisse aus der Wiederholungsbefragung
Im Rahmen des Projekts wurden auch die Ergebnisse einer erneuten Waldbesitzerbefragung analysiert, die nach einer ersten Befragung im Jahr 2000 nun erneut durchgeführt wurde. Die Befragung zielte darauf ab, die Entwicklungen in den Besitzmotiven, der Bewirtschaftungsintensität und der soziodemografischen Struktur der Waldbesitzenden zu erfassen. Hier zeigte sich, dass besonders Kleinstwaldbesitzende in den Umfrageergebnissen unterrepräsentiert waren. Dieser geringe Rücklauf aus der Kleinstprivatwaldgruppe ist auf das oft niedrige wirtschaftliche Interesse an der Waldbewirtschaftung in dieser Gruppe zurückzuführen. Daher bleibt ein umfassendes Bild für den in NRW typischen Waldbesitz schwierig. Die Waldbesitzenden in NRW sehen den aktuellen Wandel und die Herausforderungen durch Klimawandel und Kalamitäten als Gelegenheit, ihre Wälder naturnäher zu gestalten. Die Bereitschaft, Mischwälder zu fördern und standortangepasste Baumarten zu pflanzen, ist gestiegen.
Viele Eigentümerinnen und Eigentümer äußern jedoch den Wunsch nach mehr Freiheit in der Bewirtschaftung, etwa bei der Baumartenwahl, und lehnen bürokratische Hürden ab. Dies zeigt das zunehmende Interesse an einer selbstbestimmten Waldpflege, die an die individuellen Gegebenheiten angepasst ist.
Struktur der Forstzusammenschlüsse in Bayern und Unterschiede zu NRW
Ein weiterer Schwerpunkt der Forschung lag auf der Erfassung der Zusammenschlussstruktur der forstlichen Zusammenschlüsse in Bayern. Die dortige Durchschnittsgröße eines Zusammenschlusses liegt bei ca. 10.000 Hektar. In Bayern sind etwa 75 % der Privatwaldfläche in Forstbetriebsgemeinschaften (FBGen) organisiert, allerdings betrifft dies überwiegend größere Waldbesitze und erreicht nur ca. 25 % der privaten Forstbetriebe. Der Kleinstprivatwald (kleiner 5 ha) ist dort kaum vertreten und bleibt häufig außerhalb der organisierten Forststrukturen. In NRW hingegen sind zwar insgesamt weniger Waldflächen organisiert und auch die Durchschnittsgröße von Zusammenschlüssen ist wesentlich geringer, aber der Anteil der Kleinstwaldbesitzenden in den Zusammenschlüssen ist deutlich höher. Die größeren und professionelleren Zusammenschlüsse legen, ökonomisch bedingt, einen großen Fokus auf die Holzvermarktung. Es ist bisher nicht gelungen, eine abweichende Zielsetzung zukünftiger Waldeigentümergenerationen in den Organisationen zu integrieren.
Fazit
Die Abschlussveranstaltung des Projekts „Waldeigentum in der Krise“ hat verdeutlicht, dass der Wandel in der Waldbesitzerstruktur, der Klimawandel und die Urbanisierung Herausforderungen für den Privatwald darstellen. Es zeigt aber auch, dass Waldbesitzende zunehmend differenziertere Ziele mit ihrem Wald verfolgen. Die Ergebnisse zeigen, dass für viele Waldbesitzende in NRW der Wald nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine persönliche Bedeutung hat. Vor allem die Kleinstwaldbesitzenden benötigen spezifische Angebote und Unterstützung, um auch bei geringer Flächengröße einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung leisten zu können.
Autor: Friedrich Reichert, Wald und Holz NRW