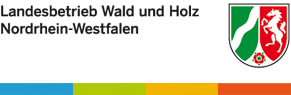Die Buche
Eine Generalistin für die stoffliche Holzverwendung?!
Deutschlandweit bestockt die Buche (Fagus sylvatica) ca. 17 %, innerhalb Nordrhein-Westfalens ca. 19 % der Waldfläche, was sie sowohl im Bund als auch im Land zur häufigsten Laubbaumart macht (BWI 2022). Im Waldbaukonzept NRW wird die Buche in einer Vielzahl der Waldentwicklungstypen als führende, standortgerechte Baumart oder als Begleitbaumart benannt und vielerorts zur Begründung strukturreicher Mischwälder empfohlen. Demzufolge ließe sich auch in Zukunft ein entsprechendes Rohholzaufkommen der Buche erwarten. Doch schlägt sich dies auch in der derzeitigen stofflichen Holzverwendung nieder?
Derzeit liegt die stoffliche Verwendung von Buchenholz schwerpunktmäßig im Bereich furnierbasierter Werkstoffe (Sperrholz, Formsperrholz, kunstharzimprägniertes Spezialsperrholz, Furnierschichtholz), der Herstellung von Möbeln, Interieur (z.B. Fußböden, Treppen, Türen), verschiedensten Alltagsgegenständen (z.B. Küchengegenstände, Kinderspielzeug) sowie der Verbindungstechnik (z.B. Dübel). In der Holzwerkstoffindustrie wird Buchenholz in Teilen bei der Span- und Faserplattenherstellung eingesetzt. Bei der Zellstoff- und Papierherstellung spielt Buche im Besonderen bei der Bereitstellung kurzfaserigen Zellstoffs eine Rolle.
Großes Potenzial für den Einsatz von Buchenholz bergen insbesondere holzbasierte Bioraffinerien sowie „Smart Materials“, die für die Zukunft eine steigende Nachfrage erwarten lassen (Stichwort: holzbasierte Bioökonomie). Nebenprodukte aus vorgelagerten Verarbeitungsstufen und geringwertige Industrieholzsortimente der Buche liefern dabei die Basis, um aus den chemischen Grundbestandteilen Cellulose, Hemicellulose und Lignin Grundstoffe etwa zur Herstellung von Klebstoffen, Bindemitteln oder Basisstoffen für den 3D-Druck zu generieren (z.B. UPM Bioraffinerie, Leuna). Letztere basieren bislang vornehmlich auf fossilen Rohstoffen. Buchenzellstoff eignet sich zudem zur Herstellung von textilen Spezialfasern (z.B. TENCELTM Modal) sowie holzbasierten Carbonfasern (z.B. WDBSD CF®, Technikum Laubholz BW).
Die Herstellung von verklebten Bauholzprodukten für den konstruktiven Holzbau (z.B. Brettschichtholz) ist derzeit vom Nadelholz dominiert. Doch die Studiengemeinschaft Holzleimbau erwirkte vor zehn Jahren eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Brettschichtholz (BSH) aus Buche sowie BSH-Buchen-Hybridträger. Dies sowie die Entwicklung von innovativen Buchen-Furnierschichtholzträgern (z.B. BauBuche®) legten die Grundlagen für die Verwendbarkeit von Buchenholz auch im konstruktiven Holzbau. Neben den technologischen Eigenschaften einer Holzart, ihrer Bearbeitbarkeit sowie Zulassung ist die Verfügbarkeit ein entscheidendes Kriterium dafür, welche Baumarten bei der Herstellung von Brettschichtholz zum Einsatz kommen. Häufig ist es also eine Frage der „besseren“ Alternative, die aufgrund der für Bauschnittholz sowie verklebte Holzbauprodukte teils herausfordernden technologischen Eigenschaften der Buche bislang häufig „Fichte“ oder „Kiefer“ hießen. Wenn sich künftig die Verfügbarkeit der Holzarten auf dem Markt ändert, könnten sich jedoch auch für die Buche weitere Verwendungen – etwa beim Bauholz – finden.
Basierend auf den technologischen Eigenschaften der Buche sind die stofflichen Verwendungsmöglichkeiten generell vielfältig, in einigen Bereichen jedoch nicht gänzlich genutzt. Insgesamt zeigen die Entwicklung innovativer Laubholzprodukte, die holzbasierte Bioökonomie und die Herstellung sogenannter Smart Materials (z.B. Carbonfasern) zunehmende Potenziale für eine stoffliche Verwendung von Buchenholz. Eine Veränderung des Holzartenportfolios könnte weitere stoffliche Nutzungspotenziale für die Baumart Buche erschließen.
Autor: Dr. Lukas Emmerich, Wald und Holz NRW