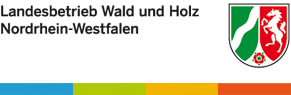Folienlagerung von Fichten-Kalamitätsholz
Fünfjähriges Langzeitmonitoring im Raum Arnsberg abgeschlossen
Die Folge von Kalamitätsereignissen sind oft unerwartet hohe Mengen Rohholz, die zu einem plötzlichen Überangebot führen. Zur Sicherung dieser Holzmengen für die inländische Holzverwendung werden häufig Konservierungsverfahren herangezogen. Diese zielen auf den Erhalt der Holzeigenschaften und die Vermeidung von Wertminderungen ab und sollen eine bedarfsbedingte Marktzuführung des Holzes unter verbesserten Absatzbedingungen ermöglichen. Ein Baustein in diesem Kontext bilden Folienlagerungsverfahren, die im Rahmen eines auf 5 Jahre angelegten Versuches für Fichten-Kalamitätsholz untersucht wurden.
Ziel des angelegten Langzeitversuches war es, die Eignung des ‚Baden-Württembergischen Folienlager-Verfahrens‘ zur Konservierung von „Käferholz“ zu untersuchen. Im Arnsberger Wald wurden dazu 10 Folienlager mit ca. 300 m³ Rundholz (gute Qualitäten) je Lager errichtet, die anschließend doppellagig und luftdicht einfoliert wurden. Vor Verschluss des Folienlagers wurde der Borkenkäferbefall an den einzulagernden Abschnitten stichprobenartig untersucht. Eine Einweisung in das ‚Baden-Württembergische Folienlager-Verfahren‘ erhielten die Projektmitarbeitenden von der Firma Wood-Packer, die sich auf Folienlagerungsverfahren spezialisiert hat.
Wissenschaftlich begleitet und dokumentiert wurde das Projekt durch das Zentrum für Wald und Holzwirtschaft (Team Waldbau, Team Waldschutz und Team Holzwirtschaft). Die Folienlager wurden im 14-tägigen Rhythmus angefahren, um Sauerstoff- und CO2-Gehalt unter der Folie zu messen, zu dokumentieren und die Folie auf Beschädigungen hin zu kontrollieren. Bereits nach wenigen Wochen unter Folie war in den zehn Poltern nahezu kein Sauerstoff mehr messbar. Ein Anstieg des Sauerstoffgehaltes, der das Risiko des Pilzwachstums und Holzabbaus während der Lagerung drastisch erhöht, wies auf Undichtigkeiten in der Folie hin. Diese wurden nach Feststellung umgehend geschlossen und führten im Anschluss zu einem Absinken der O2-Gehalte. Regelmäßige Kontrollen der Dichtigkeit von Folienlagern stellen demnach die unerlässliche Maßnahme zur Garantie einer erfolgreichen Holzkonservierung unter Folie dar und sind durchzuführen. Maßgebliche Beschädigungsquellen an den untersuchten Folienlagern waren Mäusefraß, herabfallende Äste, umgefallene Dürrständer oder bei entsprechender Windexposition durch Reibungen zwischen Folie und Holz entstandene Löcher.
Alle Folienlager wurden im Sommer 2019 errichtet; im Halbjahres-Rhythmus wurde je ein Folienlager geöffnet, sodass im September 2024 das letzte der 10 Folienlager nach über 5 Jahren Lagerungsdauer aufgelöst wurde. Vor Ort wurden nach jeder Folienlageröffnung stichprobenartig Fichten-Abschnitte mit einem mobilen Bandsägewerk eingeschnitten und hinsichtlich des Auftretens von Fäule sowie weiterer qualitätsmindernder Merkmale betrachtet. Dort deuteten sich bereits Zusammenhänge zwischen dem Verlauf des O2-Gehaltes über die Gesamtlagerungsdauer (Dichtigkeit des Folienlagers) sowie der Holzqualität an. Es gilt: Je länger Folienlager eine Undichtigkeit aufweisen, je größer ist die Gefahr von massiven Qualitätsminderungen durch Fäulepilze. In diesem Zusammenhang wurden für ausgewählte Folienlager Probeeinschnitte beim Sägewerk Egger durchgeführt, um den Qualitätserhalt durch Folienlagerung unter Berücksichtigung der Gesamtlagerungsdauer bewerten zu können (Betrachtungszeitraum: 5 Jahre).
Die über die vergangenen 5 Jahre an zehn Folienlagern erhobenen Daten und Ergebnisse der Probeeinschnitte werden derzeit im Zentrum für Wald und Holzwirtschaft sowie Austausch mit der Firma Egger ausgewertet und im Anschluss veröffentlicht. Vor dem Hintergrund zunehmender Schadensereignisse wird die langfristige Lagerung von Rohholz zukünftig immer wichtiger, sodass die Ergebnisse eine wichtige Ergänzung zu dem Praxisleitfaden „Holzkonservierung im Folienlager" (Wald und Holz NRW) darstellen werden.
Hintergrund
In Deutschland stellt Fichtenholz das mengenmäßig wichtigste Bau- und Konstruktionsholz dar und prägt somit die stoffliche Holzverwendung. Als Folge des Orkantiefs Friederike (2018) und der sich anschließenden Borkenkäferkalamität waren plötzlich enorme Mengen Fichtenholz auf dem Rohholzmarkt verfügbar. Eine Strategie, diese unerwartet hohen Mengen Fichtenholz für die inländische Verwendung zu sichern war, das Kalamitätsholz über einen gewissen Zeitraum hinweg zu konservieren und es zu einem späteren Zeitpunkt bedarfsbedingt der Verarbeitung zuzuführen. Verschiedene Konservierungsverfahren stehen für Kalamitätsholz zur Verfügung (Folienlager, Nasslager, Trockenlager). Im Sommer 2019 hat Wald und Holz NRW (Zentrum für Wald und Holzwirtschaft, Fachbereich II „Landeseigener Forstbetrieb“) im Austausch mit der Fa. Egger (Sägewerksstandort Brilon) daher einen Langzeitversuch zur Folienlagerung gestartet. Zehn Folienlager wurden angelegt und nach dem ‚Baden-Württembergischen Verfahren‘ mit je ca. 300 m³ Kalamitätsholz errichtet. Dieses in den 1990er Jahren entwickelte ‚Baden-Württembergische Verfahren‘ strebt dabei einen vollständigen Abschluss (hier: Einfolierung) des Holzes von der Umgebungsluft an und verhindert so einen Holzabbau durch ein Absenken des Sauerstoffgehaltes im Folienlager. Ein dauerhaft geringer Sauerstoffgehalt im Folienlager ist dabei das maßgebliche Kriterium für den Erhalt der Holzeigenschaften.
Autoren: Karin Müller, Dr. Carolin Stiehl, Dr. Lukas Emmerich, Wald und Holz NRW