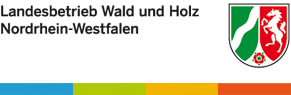Tag des Baumes am 25. April
Die Roteiche: Chancen und Risiken für NRWs Wälder im Klimawandel
Münster, 22.04.2025 – Am Tag des Baumes, dem 25. April, steht in diesem Jahr die Roteiche im Mittelpunkt – der Baum des Jahres 2025. Besonders im Herbst fallen ihre orange bis rot leuchtenden Blätter auf. Die Roteiche wächst auf verschiedenen Böden, selbst wenn Wasser oder Nährstoffe knapp sind. Auch mit schwierigeren Bedingungen kommt sie gut zurecht. In Mischwäldern, zum Beispiel zusammen mit Buchen, Hainbuchen, Lärchen, Winterlinden, Edelkastanien oder Küstentannen, trägt sie zur Vielfalt bei. Gerade in Zeiten des Klimawandels zeigt sie Potenzial als widerstandsfähige Baumart. Gleichzeitig bringt sie jedoch auch Herausforderungen mit sich.
Vorteile der Roteiche: Wachstum und Anpassungsfähigkeit
Ursprünglich aus Nordamerika stammend, wächst die Roteiche bereits seit über 100 Jahren in Nordrhein-Westfalen. Besonders im Münsterland, zum Beispiel in der Haard, am Niederrhein und entlang der Rheinschiene findet man sie in einzelnen Mischwäldern. Hier stellt sie ihre Vorteile, darunter ihr schnelles Wachstum und ihre Anpassungsfähigkeit, unter Beweis.
Dr. Carolin Stiehl, Leiterin des Teams Waldbau im Zentrum für Wald und Holzwirtschaft, der Einrichtung für Forschung und Wissenstransfer von Wald und Holz NRW: „Die Roteiche zählt laut Waldbaukonzept NRW zu den etablierten eingeführten Baumarten. Sie ist eine interessante Baumart zur Ergänzung des heimischen Baumartenspektrums, auch im Hinblick auf die Veränderungen im Klimawandel. Unsere heimischen Eichenarten, die Stiel- und die Traubeneiche, wird sie dennoch nicht ersetzen.“
Waldbesitzenden empfiehlt Dr. Carolin Stiehl, die Roteiche in Mischbestände zu integrieren: „Die Roteiche kommt auf vielen Standorten zurecht und gilt als widerstandsfähig. Sie wächst schnell und hat gute Holzeigenschaften, muss aber differenziert betrachtet werden.“
Herausforderungen: sehr trockene Böden und kritische ökologische Effekte
Auf einzelnen Standorten kann sie sich sehr zahlreich verjüngen. Ob sich dies negativ auf andere, heimische Baumarten auswirken kann, wird aktuell aus verschiedenen Blickwinkeln heraus beobachtet und diskutiert. Bei der Einbringung eingeführter Baumarten wie der Roteiche sind einige naturschutzfachliche und Zertifizierungsvorgaben zu beachten. Auf sehr armen, trockenen oder kalkreichen Böden ist die Roteiche nicht mehr zu empfehlen. Gleichzeitig ist sie gegenüber Staunässe empfindlich. Zudem zersetzt sich ihr Laub nur langsam. Einerseits ist das positiv, weil es Schutz vor Waldbränden bieten kann – ihre Blätter sind auf dem Waldboden recht dicht gelagert und halten so viel Feuchtigkeit. Andererseits wirkt sich die schlechte Zersetzung des Laubs negativ auf das Leben im Boden und den Nährstoffkreislauf aus. Die Artenvielfalt an Roteichen ist geringer als bei heimischen Eichenarten. Heimische Eichen sind besonders wertvoll für viele Tierarten und bieten spezielle Lebensräume und Nahrung für Wildtiere.
Roteichen brauchen wie auch die heimischen Eichenarten viel Licht und wachsen im Schatten eines geschlossenen Kronendachs nur schlecht. Ihr Holz ist für den Innenbereich gut geeignet, zum Beispiel für Möbel und Parkett. Im Außenbereich eignen sich dagegen die heimischen Eichenarten besser. Junge Roteichenpflanzen werden zudem gerne von Reh- und Rotwild gefressen.
Die Fachleute des Zentrums für Wald und Holzwirtschaft in Arnsberg kennen Vor- und Nachteile der Baumart und haben ihre Entwicklung genau im Blick, um den Wald langfristig zu stärken. Die Roteiche zeigt, wie vielseitig und herausfordernd der Umgang mit unterschiedlichen Baumarten im Klimawandel sein kann.