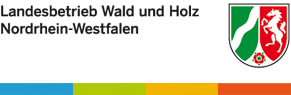Tag des Baumes am 25. April
Die Robinie - eine spröde Schönheit in NRW
Der Tag des Baumes ruft ins Gedächtnis, wie wertvoll Wald und Bäume für den Menschen und eine gesunde Umwelt sind. Wald und städtisches Grün lockern die Umgebung auf, verbessern das örtliche Klima und tun dem Menschen gut. Ein zum Beispiel für das Ruhrgebiet typischer Baum ist die Robinie, auch Scheinakazie genannt. Sie ist der Baum des Jahres 2020.

Wie viele Vorfahren der Bewohner Nordrhein-Westfalens stammt die Robinie nicht von hier. Sie stammt ursprünglich aus Nordamerika und wird seit über 300 Jahren in Deutschland angebaut. Sie ist anspruchslos und wächst noch auf trockenen Böden mit schlechter Nährstoffversorgung. Deshalb wurde Sie im Ruhrgebiet zur Rekultivierung von Halden und Industriebrachen gepflanzt. In den Wäldern landesweit ist sie zwar auch generell von Interesse, sie hat jedoch die Tendenz andere Baumarten zu verdrängen. „Unsere Forstleute bauen unsere Wälder langfristig zu artenreichen und strukturreichen Mischwäldern um“, sagt Andreas Wiebe, Leiter von Wald und Holz NRW. „Als Mischbaumart in den Wäldern der Zukunft wird die Robinie wegen ihrer Tendenz zur Ausbreitung keine große Rolle spielen. Hier setzen wir je nach Standort Eichen, Buchen, Weißtanne aber zum Beispiel auch die Esskastanie“. Mit ihrem sperrigen Wuchs, ihren Fiederblättern und paarigen Dornen am Zweig ist die Robinie ein markanter Baum auch an Straßen, Plätzen und in Parks. Besonders ansprechend ist ihre Blütenpracht. Die stark duftenden Blüten hängen in 10 bis 25 Zentimeter langen Trauben vor dem Blattaustrieb an den Zweigen. Sie bieten reichlich Nektar und sind eine beliebte und wichtige Bienen- und Insektenweide. Ihr Honig wird Akazienhonig genannt.
Das Holz der Robinie ist gegen Holzfäule widerstandsfähig, gleichzeitig biegsam, fest und äußerst hart. Robinienholz ist das witterungsbeständigste Holz Europas. Auch ohne Konservierung bleibt es bei einer Nutzung im Außenbereich lange haltbar. Robinienholz wird häufig für Spielplatzgeräte und Gartenmöbel eingesetzt und ist eine Alternative zur Verwendung von Tropenhölzern. Holznutzung ist Klimaschutz. Wenn das dem Wald entnommene Holz nicht als Brennholz genutzt wird, sondern zu Holzprodukten verarbeitet wird, bleibt dadurch Kohlenstoff gebunden. Langlebige Holzprodukte haben einen doppelten Vorteil: Sie speichern den Kohlenstoff über längere Zeiträume und müssen seltener ersetzt werden, was Energie zur Herstellung von Ersatzprodukten spart. In NRW werden insgesamt 330 Mio. Tonnen CO2 in Holzprodukten gespeichert.

Hintergrund: Internationaler Tag des Baumes
Die Idee für den Tag des Baumes stammt aus dem 19. Jahrhundert. Sie geht auf den Farmer und Journalisten Julius Sterling Morton zurück, der zu den ersten Siedlern Nebraskas (USA) gehörte. In der dortigen Landschaft gab es nur wenige Bäume, als Sterling Morton begann sein Grundstück zu bepflanzen. Im Jahre 1872 schlug er vor den "Arbor Day" einzuführen - einen Feiertag zum Bäume pflanzen. Gleich beim ersten Mal wurden mehr als eine Million Bäume in Nebraska gepflanzt und nach und nach verbreitete sich die Idee.
Am 27. November 1951 beschlossen die Vereinten Nationen den Tag des Baumes. Er soll die Bedeutung des Waldes für den Menschen und die Wirtschaft im Bewusstsein halten. Der deutsche „Tag des Baumes“ wurde erstmals am 25. April 1952 begangen und findet seitdem jährlich statt. Bundespräsident Theodor Heuss und der Präsident der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Bundesminister Robert Lehr, pflanzten damals im Bonner Hofgarten einen Ahorn.
In der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg waren die Deutschen Wälder übernutzt. Während des Krieges und im Anschluss durch die Übernutzung der Alliierten fanden auf zehn Prozent der deutschen Waldfläche Kahlschläge statt. So wurde in den ersten Nachkriegsjahren zwischen 9- bis 15-mal mehr Holz eingeschlagen, als nachwachsen konnte. Die Kohleförderung reichte nicht aus, um die Haushalte zu versorgen, so dass verstärkt Brennholz eingeschlagen wurde. Der Tag des Baumes 1952 diente der Rückbesinnung auf die Nachhaltigkeit - ein Prinzip, das seit 300 Jahren das Handeln der Forstwirtschaft prägt.