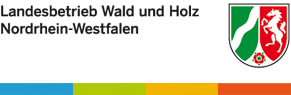Kohlenstoffbindung in Wäldern und Holzprodukten im Fokus
Wald und Holz NRW beteiligte sich an der Kohlenstofftagung des Verbands Forstlicher Versuchsanstalten in Göttingen
Über 220 Forscherinnen und Forscher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz diskutierten vom 12. bis 14. März 2025 in Göttingen über den Klimaschutzbeitrag von Wäldern und des nachwachsenden Rohstoffes Holz.
Anlass dazu gab die Tagung „Kohlenstoffbindung in Waldökosystemen und Holzprodukten“ des Deutschen Verbands Forstlicher Forschungsanstalten (DVFFA). Ausrichter war in diesem Jahr die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA) in Kooperation mit Wald und Holz NRW, vertreten durch sein Zentrum für Wald und Holzwirtschaft, sowie den forstlichen Versuchs- und Forschungseinrichtungen des deutschsprachigen Raums. Aus Österreich war das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) beteiligt, aus der Schweiz die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL).
Wald und Holz im Klimawandel
Die nachhaltige Forstwirtschaft ist eine der wenigen Landnutzungsformen, durch die der Atmosphäre mehr Kohlendioxid (CO2) entzogen, als freigesetzt werden kann. Zugleich sind die Waldökosysteme von den Folgen des Klimawandels stark betroffen, was sich in Form erhöhter Risiken und Waldschäden zeigt. So stellt sich die Frage, wie die Potenziale von Wäldern, einer nachhaltigen Waldwirtschaft sowie der Holzverwendung zur Kohlenstoffspeicherung gesichert oder gar ausgebaut werden können und wo die Möglichkeiten und Grenzen für den Klimaschutz liegen? Diese und weitere Fragen wurden während der Kohlenstofftagung in einem wissenschaftlichen Kontext beleuchtet und diskutiert.
Bedeutung klimaanpassungsfähiger Wälder und der Holzverwendung für den Klimaschutz
Die Expertinnen und Experten sind sich einig: Um die Potenziale vom Wald und des nachwachsenden Rohstoffes Holz zur Kohlenstoffspeicherung zu sichern, im besten Fall auszubauen, sind eine möglichst kontinuierliche Bewaldung mit vitalen, klimaanpassungsfähigen Wäldern sowie die Verwendung des heimisch verfügbaren, nachwachsenden Rohstoffes Holz von zentraler Bedeutung. Zunehmende Extremwetterereignisse sowie ein rasant fortschreitender Klimawandel erschweren und schränken die natürlichen Prozesse und Mechanismen in Waldökosystemen jedoch ein, sodass eine aktive Unterstützung in Form einer klugen Waldentwicklung, sowie die Wiederbewaldung nach Kalamitätsereignissen an Bedeutung gewinnen. Forschungsbedarf zeigte sich insbesondere hinsichtlich der komplexen Zusammenhänge zwischen Waldentwicklungsprozessen, unterschiedlicher Bewirtschaftungsformen und der Kohlenstoffspeicherung.
Ferner wurden mögliche Konfliktfelder zwischen der Kohlenstoffbindung im Wald sowie einer nachhaltigen Holzverwendung und weiteren Ökosystemleistungen des Waldes diskutiert. Weitere Themenschwerpunkte bildeten die CO2-Zertifizierung und Bedeutung von Substitutionseffekten.
Aktive Beteiligung und Präsenz aus Nordrhein-Westfalen
Wald und Holz NRW war durch das Zentrum für Wald und Holzwirtschaft (ZWH) aktiv in die Planung und Durchführung der Tagung eingebunden und mit zwei Fachvorträgen sowie mehreren wissenschaftlichen Postern vertreten. Maßgeblich beigetragen haben diese in den Sessions „Senken- und Speicherfunktion durch Holzverwendung“ sowie „Effekte unterschiedlicher Bewirtschaftungsmaßnahmen und Nutzungsverzicht“.
In seiner Keynote zum Klimaschutzbeitrag der Holzverwendung betonte Dr. Sebastian Rüter (Thünen Institut für Holzforschung) die zentrale Rolle des heimisch verfügbaren und nachwachsenden Rohstoffes Holz. Diesen Punkt griff Dr. Lukas Emmerich (ZWH) in einem Gemeinschaftsvortrag mit dem Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften (FIB) auf. Beleuchtet wurden Herausforderungen einer Veränderung der heimischen Rohstoffbasis „Holz“ zur Realisierung eines langfristigen Kohlenstoffspeichers in Holzprodukten am Beispiel der Baumart Birke. Untersuchungen der Kohlenstoffspeicherung auf Birkensukzessionsflächen zeigen die kurz- bis mittelfristigen Potenziale der Birke, einen zentralen Klimaschutzbeitrag übernehmen zu können. Das zeigt sie sowohl durch ihr mögliches Wachstum im Wald, als auch bei der ressourceneffizienten, nachhaltigen Holzverwendung in langlebigen Holzprodukten. Hinweise darauf gibt es auch in den Untersuchungsergebnissen des FNR-Projektes HolzSysteMe zur Herstellung von Birken-Brettschichtholz.
Ein weiterer Gemeinschaftsbeitrag ging aus dem Verbundprojekt BiCO2 hervor. Theresa Klein-Raufhake präsentierte Ergebnisse im Gemeinschaftsvortrag von Wald und Holz NRW und der Universität Münster. Im Fokus stand der Einfluss forstlichen Managements auf die ober- und unterirdische Kohlenstoffspeicherung im Wald, der in vier Waldgebieten (Niederrhein, Kernmünsterland, Arnsberger Wald, Egge-Vorberge) untersucht wurde. Dabei unterschieden sich die Kohlenstoffvorräte in der lebenden Biomasse auf 200 untersuchten Flächen kaum und werden insbesondere vom Bestandesalter, aber auch vom Basen- und Tongehalt des Standortes beeinflusst. Unterschiede zeigten die Projektregionen hingegen im Gesamtkohlenstoffvorrat des Bodens. Dabei spiele der Mineralboden für eine langfristige, stabile Kohlenstoffspeicherung eine zentrale Rolle.
Ferner werde der Kohlenstoffkreislauf in Waldökosystemen durch abiotische Störungen ebenso wie biotische Schadfaktoren beeinflusst. Diesen Punkt adressierte Dr. Ralf Petercord (MLV NRW) und beleuchtete die Rolle von Schadorganismen im Klimawandelgeschehen sowie deren Auswirkungen auf den Kohlenstoffkreislauf in Waldökosystemen. Schadorganismen profitieren dabei nicht nur direkt vom Klimawandel, zugleich schwächen die veränderten Witterungsbedingungen die Wirtspflanzen und machen sie damit als Nahrungsquelle für Schadorganismen leichter nutzbar. In der aktuellen Diskussion über die Kohlenstoffspeicherfähigkeit des Waldes werde die zunehmende Bedeutung biologischer Störungen jedoch allgemein unterschätzt, was sich unmittelbar auf eine optimale Nutzung des Klimaschutzpotentials des Waldes auswirkt. Dr. Ralf Petercord resümierte: Einheimische und invasive Schadorganismen werden die klimatischen Veränderungen der Waldökosysteme maßgeblich beschleunigen, wobei hohe Vorräte und überalterte Bestände diese Entwicklung begünstigen. Daher sei beim natürlichen Klimaschutz der Fokus auf die Senkenleistung des Waldes zu legen. Diese sei unter Berücksichtigung des Biodiversitätserhalts zu maximieren und in den stabileren Holzproduktespeicher zu transformieren.
Detailinformationen zu allen Fachvorträgen sowie Postern finden Sie im Tagungsband.
Gefördert wurde die Tagung mit Mitteln des Landes Niedersachsen im Rahmen des Sondervermögens "Wirtschaftsförderfonds – Ökologischer Bereich".