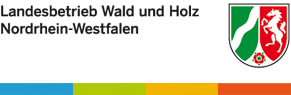6. FSC-Walddialog
Impulse für ein zukunftsfestes Waldmanagement im Klimawandel
Arnsberg, 10. April 2025 – Der Klimawandel stellt die Forstwirtschaft vor grundsätzliche Herausforderungen. Extremwetter, Kalamitäten, Schadorganismen und Unsicherheiten bei der Baumartenwahl bestimmen den Alltag vieler Waldbewirtschaftender. Der 6. FSC-Walddialog widmete sich diesen Fragen mit dem Schwerpunkt: "Welche (Baumarten-)Wahl haben wir?". Rund 60 Fachleute aus Praxis, Wissenschaft, Verwaltung und Verbänden kamen am 3. und 4. April 2025 im Forstlichen Bildungszentrum Arnsberg zusammen, um aktuelle Erkenntnisse auszutauschen, Lösungsansätze zu diskutieren und Strategien für klimaresiliente Wälder zu entwickeln. Veranstalter waren FSC Deutschland und der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen.
Begrüßung: Gemeinsamer Auftakt mit klarer Haltung
Thomas Kämmerling, Leiter von Wald und Holz NRW, eröffnete die Veranstaltung mit einem deutlichen Appell: „Die Wahl geeigneter Baumarten ist eine Schlüsselfrage der Waldzukunft. Doch die Transformation gelingt nur im Dialog." Er unterstrich die Bedeutung eines integrierten Ansatzes, der wissenschaftliche Erkenntnisse, waldbauliches Erfahrungswissen und gesellschaftliche Verantwortung verbindet. NRW sei mit dem FSC-zertifizierten Staatswald, dem Waldbaukonzept NRW, dem Wiederbewaldungskonzept und dem digitalen Portal Waldinfo.NRW gut gerüstet. Gleichzeitig verdeutlichten die rund 133.000 Hektar Kalamitätsflächen in NRW seit 2018 die Dringlichkeit zielgerichteter Wiederbewaldung. Jeder dieser Flächen, so Kämmerling, komme eine Funktion als "Experimentierfeld für klimaresiliente Baumartenkombinationen" zu.
Fachvorträge mit Tiefe: Modellierungen, Baumartenstrategien und forstliche Handlungsempfehlungen
Den Auftakt des inhaltlichen Programms machte Dr. Christiane Helbig (TU Dresden) mit einem umfassenden Überblick zu aktuellen und künftigen Waldschutzschwerpunkten. Sie stellte die Ergebnisse aus dem Monitoringbericht 2023 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel vor und betonte die zunehmende Bedeutung biotischer Schadfaktoren wie Insekten, Pilzen, Wild, Mäusen und invasiven Arten. Im Fokus stand die Erkenntnis, dass abiotische Stressoren wie Trockenheit, Hitze und Stürme die Vitalität von Bäumen reduzieren und diese in der Folge anfälliger für biotische Angreifer machen. Helbig forderte ein integriertes, risikoadaptiertes Schutzkonzept, bei dem auch der gezielte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln als "Ultima Ratio" nicht ausgeschlossen werden dürfe.
Dr. Ralf Petercord vom Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW widmete sich der Klimadynamik und dem Modellkonzept der Klimahüllen. Er machte deutlich, dass es sich bei Klimahüllen um idealisierte Darstellungen ökologischer Nischen entlang der Achsen von Jahresmitteltemperatur und Niederschlagsmenge handelt – mit klaren Limitationen: „Das Klima verschiebt sich nicht – wir bekommen ein völlig neues.“ Klimahüllen seien nützliche Annäherungen, aber kein Ersatz für fundiertes waldbauliches Handeln. Petercord plädierte für eine Stärkung klassischer forstlicher Steuerungselemente wie Verjüngungspflege, Pflegekonzepte, Zielbaumauswahl und risikodiversifiziertes Mischungsmanagement.
Dr. Axel Albrecht von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg präsentierte auf Basis umfangreicher Eignungsbewertungen die Vulnerabilität klassischer Hauptbaumarten (Fichte, Buche, Kiefer, Eiche) und zeigte gleichzeitig das Potenzial sogenannter "Alternativbaumarten" auf. Grundlage seiner Bewertung war eine multikriterielle Methodik, die Aspekte wie Dürretoleranz, Frostempfindlichkeit, Bodeneignung, biotische Resistenz und Ertragspotenziale berücksichtigt. Besonders hervorgehoben wurden Winterlinde, Elsbeere, Hopfenbuche, Flaumeiche und Libanonzeder. Entscheidend sei ein vorsichtiges Anreichern, kein radikaler Austausch.
Prof. Dr. Erwin Hussendörfer von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf argumentierte in seinem Vortrag, dass die Rotbuche – trotz zunehmender Kritik – keineswegs abgeschrieben werden sollte. Auf Basis von Herkunftsversuchen und Langzeitdaten aus Urwaldrelikten in den Karpaten verwies er auf die hohe genetische und epigenetische Variabilität der Buche. Strukturreiche, mehrschichtige Buchenwälder verfügten über stabile Waldinnenklimata, die auch unter Trockenstress positiven Einfluss auf die Vitalität der Bäume hätten. Entscheidend sei, standortspezifisch angepasste Herkünfte zu nutzen und die natürliche Selektion in der Naturverjüngung zu stärken.
Den Abschluss der Vortragsreihe gestaltete Elmar Seizinger, FSC Deutschland, mit einem Einblick in die laufende Revision des deutschen FSC-Standards. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie der Standard zukünftig mit der Baumartenwahl umgeht. Seizinger kündigte an, dass FSC Deutschland daran arbeitet, messbare Indikatoren zur Baumarteneignung zu entwickeln. Dies soll die Entscheidungsfindung für Zertifikatsinhabende erleichtern und gleichzeitig Spielräume für geeignete, auch nicht-heimische Baumarten schaffen – im Sinne von Resilienz und Nachhaltigkeit.
Exkursion am 4. April: Praxis trifft Forschung
Der zweite Veranstaltungstag stand im Zeichen des Erfahrungsaustauschs vor Ort.
Ein besonderes Highlight war die Naturwaldzelle Hellerberg, die seit 1976 als Freilandlabor dient. "Die Langzeitbeobachtungen zeigen, dass wir bei der zukunftsfähigen Baumartenwahl nicht nur auf neue Arten setzen sollten, sondern auch das Anpassungspotenzial einheimischer Arten wie der Buche besser verstehen und nutzen müssen", erläuterte Rudolf Hansknecht, Fachbereichsleiter Landeseigener Forstbetrieb bei Wald und Holz NRW.
Ein weiterer zentraler Programmpunkt war die Besichtigung der SUPERB-Demonstrationsflächen, auf denen Baumartenmischungen und Herkünfte im Sinne eines risikoausgleichenden „Portfolio-Ansatzes“ getestet werden. Die gezeigten Flächen wurden u. a. 2023 nach dem Wiederbewaldungskonzept NRW bepflanzt.
Im Lehr- und Versuchsrevier Hirschberg wurde eine innovative Kombination aus Harvester-Verhau und Stockachselpflanzung demonstriert. Die Technik wurde 2021 auf einer Fichtenkalamitätsfläche eingeführt. Der Verhau aus abgestorbenen Stämmen schafft ein mikroklimatisch begünstigtes Umfeld und wirkt gleichzeitig verbissmindernd. Die Ergebnisse zeigen gute Anwuchserfolge und einen vielversprechenden Beitrag zur Schutzfunktion auf waldbaulich sensiblen Flächen.
"Die verschiedenen Ansätze zeigen, dass wir die Baumartenwahl im Klimawandel differenziert betrachten müssen", so Hansknecht. "Besonders vielversprechend ist der Ansatz, klimaangepasste Baumartenmischungen mit verschiedenen Herkünften zu etablieren, um das Risiko zu streuen und die Widerstandsfähigkeit der Waldökosysteme zu erhöhen."
Ausblick
Der 6. FSC-Walddialog 2025 machte deutlich: Die Herausforderungen sind groß, die Antworten komplex. Doch das Interesse an einem fachlich fundierten, partnerschaftlich getragenen Transformationsprozess ist ungebrochen. Die Veranstaltung zeigte, dass differenzierte Strategien, wissenschaftlich begleitete Praxisprojekte und ein offener Dialog die Schlüsselfaktoren für zukunftsfähige Wälder sind.
Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe sind hier zu finden.
Ansprechpartner
Elke Hübner-Tennhoff
Kurt-Schumacher-Str. 50 b
59759 Arnsberg
Tel.: +49 251 91797 211
Mobil: +49 160 7717162
Fax: +49 2931 7866 333
E-Mail: senden
vCard: laden
Fachlicher Ansprechpartner
Wald und Holz NRW
Rudolf Hansknecht
Kurt-Schumacher-Str. 50 b
59759 Arnsberg
Tel.: +49 251 91797 282
Mobil: +49 171 5870056
E-Mail: senden
vCard: laden