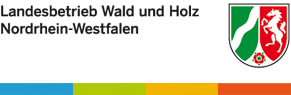Waldzustand
Waldzustandsbericht
Der Waldzustand in NRW wird regelmäßig im Rahmen sogenannter Waldzustandserhebungen erfasst, ausgewertet und in Waldzustandsberichten dokumentiert.
Ministerin Gorißen stellt Waldzustandsbericht 2025 vor: Wald erholt sich leicht – aber keine Trendwende
Das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz teilt mit: Die Gesundheit des Waldes geht alle an. Als Klimaschützer, Holzlieferant, Lebensraum für Tiere und Pflanzen und beliebter Erholungsraum hat der Wald grundlegend wichtige Funktionen für die Natur und die Menschen. Um den Wald besser schützen zu können, sind Daten notwendig, die Forstfachleute des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen über mehrere Monate im Jahr sammeln, auswerten und in der jährlichen Waldzustandserhebung veröffentlichen. Die zentralen Ergebnisse des Waldzustandsberichts 2025 präsentierte Ministerin Silke Gorißen am 20. November in Düsseldorf:
Ministerin Silke Gorißen: „Die gute Nachricht zuerst: Dem Wald in Nordrhein-Westfalen geht es etwas besser als in den vergangenen Jahren, die seit 2018 stark von der Borkenkäferplage und ihren Folgen geprägt waren. Nach mehreren schweren Jahren gewinnt der Wald leicht an Kraft und damit gewinnen wir auch mehr Zeit für die notwendige Anpassung an den Klimawandel.“ Die Ministerin weiter: „Die Wälder konnten von den guten Witterungsbedingungen und ausreichender Wasserversorgung in den Waldböden profitieren, so etwa bei der Buche. Zudem nimmt die Fläche mit jungen Bäumen zu – der vorangetriebene Waldumbau wirkt. Dennoch sind vielerorts die Zustände der Bäume weiter kritisch – gerade bei der Eiche. Wir müssen die Widerstandsfähigkeit der Wälder weiter stärken und den Umbau zu starken Mischwäldern fortsetzen. Die Wiederbewaldung bleibt eine Generationenaufgabe.“
Wälder haben sich etwas erholt – Waldumbau macht sich bemerkbar
Die insgesamt niederschlagsreichen Jahre 2023 und 2024 sowie ein meist ausreichend nasses 2025 haben den Bäumen geholfen, die Schäden der vorangegangenen Extremjahre zumindest in Teilen auszugleichen. 29 Prozent der Bäume zeigten in diesem Jahr eine gesunde, dichte Baumkrone aus Blättern oder Nadeln. Das sind zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Auch der Anteil der Bäume mit einer nur leicht verlichteten Krone hat sich vergrößert und zwar um drei Prozent auf nun 37 Prozent. Dementsprechend hat sich der Anteil schwer geschädigter Bäume mit stark verlichteter Krone auf 34 Prozent und damit um fünf Prozent verringert. Gleichzeitig verfestigt sich der Eindruck, dass der seit einigen Jahren vorangetriebenen Waldumbau zu wirken beginnt. Der Wald wird jünger und reicher an Baumarten. Dies zeigen auch die Ergebnisse der Landeswaldinventur. Die Fläche der Wälder, auf denen junge Bäume bis 20 Jahre wachsen, hat um gut 35.000 Hektar zugenommen. In dieser Altersklasse dominiert das Laubholz mit einem Anteil von 72 Prozent. Um diesen Erfolg zu verstetigen, ist in den kommenden Jahren eine besondere Pflege notwendig.
Dürre, Hitze, Säure- und Nährstoffeinträge schädigen Waldbäume
Diese Entwicklung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Klimawandel weitere negative Auswirkungen auf den Wald hat. Zudem sind die Einwirkungen aus Industriegesellschaft und Verkehr groß. Ursache für die Waldschäden ist nach wie vor auch die Versauerung der Waldböden durch langfristige Säure- und Nährstoffeinträge. Hinzu kommen Schäden durch die Auswirkungen des Klimawandels – Dürre und Hitze, die das Feinwurzelsystem und die Leitungsbahnen der Bäume schädigen, sowie Schäden durch Insekten wie etwa den Eichenprachtkäfer. Nicht nur Nadelbäume, sondern auch heimische Laubbäume sind stark betroffen. So ist die Eiche besonders geschädigt – nur sieben Prozent der Eichen weisen keine Kronenverlichtung auf. Zwar hat auch die Eiche von den größeren Niederschlagsmengen profitiert, doch ihr geht es weiterhin vergleichsweise schlecht. Der Buche hingegen geht es deutlicher besser: 24 Prozent der Buchen zeigen keine Schäden und 40 Prozent geringe Schäden.
Tim Scherer, Wald und Holz: „Eine gute Nachricht ist sicherlich, dass sich die Situation beim Borkenkäfer deutlich entspannt hat – das verschafft dem Wald und uns allen eine gewisse Atempause. Dennoch bleibt Wachsamkeit geboten: Geschwächte Bäume können natürlich auch von anderen Schadinsekten befallen werden, etwa vom Eichenprachtkäfer. Und auch hinsichtlich der Borkenkäfer kann ein sehr trockenes Jahr die Situation wieder verschärfen. Unsere Försterinnen und Förster beobachten die Entwicklung daher genau und stehen dem privaten Waldbesitz jederzeit beratend zur Seite.“
Förderung für die Wiederbewaldung wird fortgesetzt
Mit seiner absoluten Größe von 950.000 Hektar gehört Nordrhein-Westfalen zu den waldreichsten Bundesländern. Auf vielen Schadflächen wachsen schon junge Bäume, doch die Wiederbewaldung bleibt eine wichtige Aufgabe. Deshalb bietet das Land Nordrhein-Westfalen zur Wiederbewaldung und zur Entwicklung klimaanpassungsfähiger Mischwälder vielfältige Unterstützungsangebote an: fachliche Empfehlungen, so etwa das Waldbau- und Wiederbewaldungskonzept, digitale Informationen über Waldinfo.NRW, vielfältige Beratungsgebote der Regionalforstämter, Schulungen und finanzielle Fördermöglichkeiten für den Waldbesitz.
Die Landesregierung hat die Waldbesitzenden seit 2018 mit insgesamt mehr als 160 Millionen Euro bei der Beseitigung der Waldschäden und der Wiederbewaldung unterstützt. Allein in 2025 wurden mehr als 16,5 Millionen Euro Fördergelder bereitgestellt, um vor allem die großen Schadflächen, wieder zu bewalden. Bis Ende dieses Jahres werden damit Kalamitätsflächen im Umfang von 15.000 Hektar mit Unterstützung des Landes wieder aufgeforstet. Auch in 2026 sieht das Land vor, die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer bei der Wiederbewaldung umfassend zu unterstützen.
Hintergrund Waldzustandsbericht:
Die Waldzustandserhebung und die weiteren Untersuchungen des forstlichen Umweltmonitorings in Nordrhein-Westfalen werden seit rund 40 Jahren alljährlich durchgeführt und liefern wichtige Informationen zum ökologischen Zustand der Wälder. Die Ergebnisse sind auch eine zentrale Informationsgrundlage für die Einschätzung der vielfältigen Waldfunktionen und für die Waldbewirtschaftung.